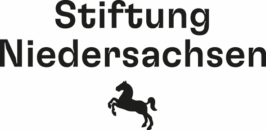Wie aus einem sehr tiefen Brunnen zieht der Cellist mit seinem Bogen den Ton aus der Tiefe des Instrumentes. Dunkel und schwarz wirkt er, bedrohlich und schauerlich, als ob ihm das Licht der Welt nicht so richtig passt. Grabesschwer setzt der dunkle Bass seinen Weg fort, unterbricht immer wieder, fragend, mit gequältem Gesicht. Was geschieht hier? Bin ich nur ein Produkt der Theorie? Dann öffnet sein Gegenüber die Augen. Aus einem noch dunkleren Loch macht sich der Bass des Klaviers bemerkbar und scheint ebenso wenig erfreut über seine Existenz zu sein. Während das Cello seine Fragen formuliert, kann das Klavier erst nur stampfen, zwischendurch immer wieder einen Cluster setzend. Beide merken, dass etwas mit ihnen passiert. Sie verändern sich, nehmen Tempo auf, steigern sich, werden wütend, ändern Klang und Farbe, mal hoch, mal tief, rasen die Reihen hoch und runter, schlagen aus, immer schneller, gehetzter, bis sie nach sechs Minuten wieder verhuschen und verschwinden. Es bleiben alle Fragen offen. Wieder Stille.
Grave – Metamorphosen für Violoncello und Klavier (1981) des polnischen Komponisten Witold Lutosławski ist ein spannendes Stück, das auch ohne Theoriestudium Eindruck hinterlässt. Wer sich für die tonalen Metamorphosen und Lutosławskis Umgang mit der Reihentechnik (Zwölftonreihe) verstehen will, dem sei der musikwissenschaftliche Artikel von Thomas Müller empfohlen: „Witold Lutosławski: Grave – Metamorphosen für Cello und Klavier (1981) Im Spannungsfeld zwischen Moderne und Tradition.“ Online zu finden unter: http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/482.aspx.

Julian Steckel und Lauma Skride scheinen das Stück hervorragend verstanden zu haben. Von der Grabesstille des Anfangs, über die eruptiven Zwölftonreihen bis hin zum auseinanderbrechenden Ende hing das Publikum in Bagband gebannt an ihrer Darbietung. Musik aus dem 20. Jahrhundert kann so mitreißend sein, das bewies der erste Teil des Konzertes eindrucksvoll. Mit Debussy und Poulenc standen zwei weitere Komponisten auf dem Programm, die zwischen Wehmut, vertrackter Theorie und spannungsreichem Finale alles auffahren, was die Moderne auszeichnet. Julian Steckel spielt so ein Programm mit der Lässigkeit eines coolen Genies. Er ist sich natürlich sehr wohl um seine herausragenden Fähigkeiten bewusst, aber tut das mit einer (bewussten) Lockerheit ab. Das bedeutet nicht, dass er nicht leidenschaftlich dabei ist. Unfreiwilliger Höhepunkt ist der dritte Satz von Poulencs Sonate für Violoncello und Klavier FP 143, bei dem ihm die Saite reißt, weil er so stark spielen muss. Darauf habe er bei dem Stück schon immer gewartet, erzählt er dem Publikum, spannt eine neue Saite auf, und weiter geht der wilde Ritt über die Saiten. Das Instrument muss beim ersten Teil eine ganze Menge mitmachen.
Lauma Skrides Klavierpart ist sicherlich zurückhaltender, aber nicht weniger überzeugend, besonders bei Brahms Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 1 e-Moll op. 38. Dieses vielgespielte und immer wieder großartig anzuhörende Stück bildete mit seinen 28 Minuten den Großteil nach der Pause. Vorher gab es noch Weberns kleine Stücke op. 11. Schnell vorbei, kaum was kapiert, fast unerträglich mysteriös. In der Zugabe bekommt man eine zweite Chance, aber ein Fragezeichen bleibt. Für Steckel und Skride gibt man aber gerne mehrere Ausrufezeichen. Bravo-Rufe und großer Applaus beendeten das Konzert, das so unglaublich lässig und perfekt daher kam, dass es fast unheimlich wurde. Vielleicht lag es auch an der Uhrzeit, denn die Nachmittagskonzerte machen allen Spaß, vor allem, wenn abends noch ein Fußballspiel ansteht.